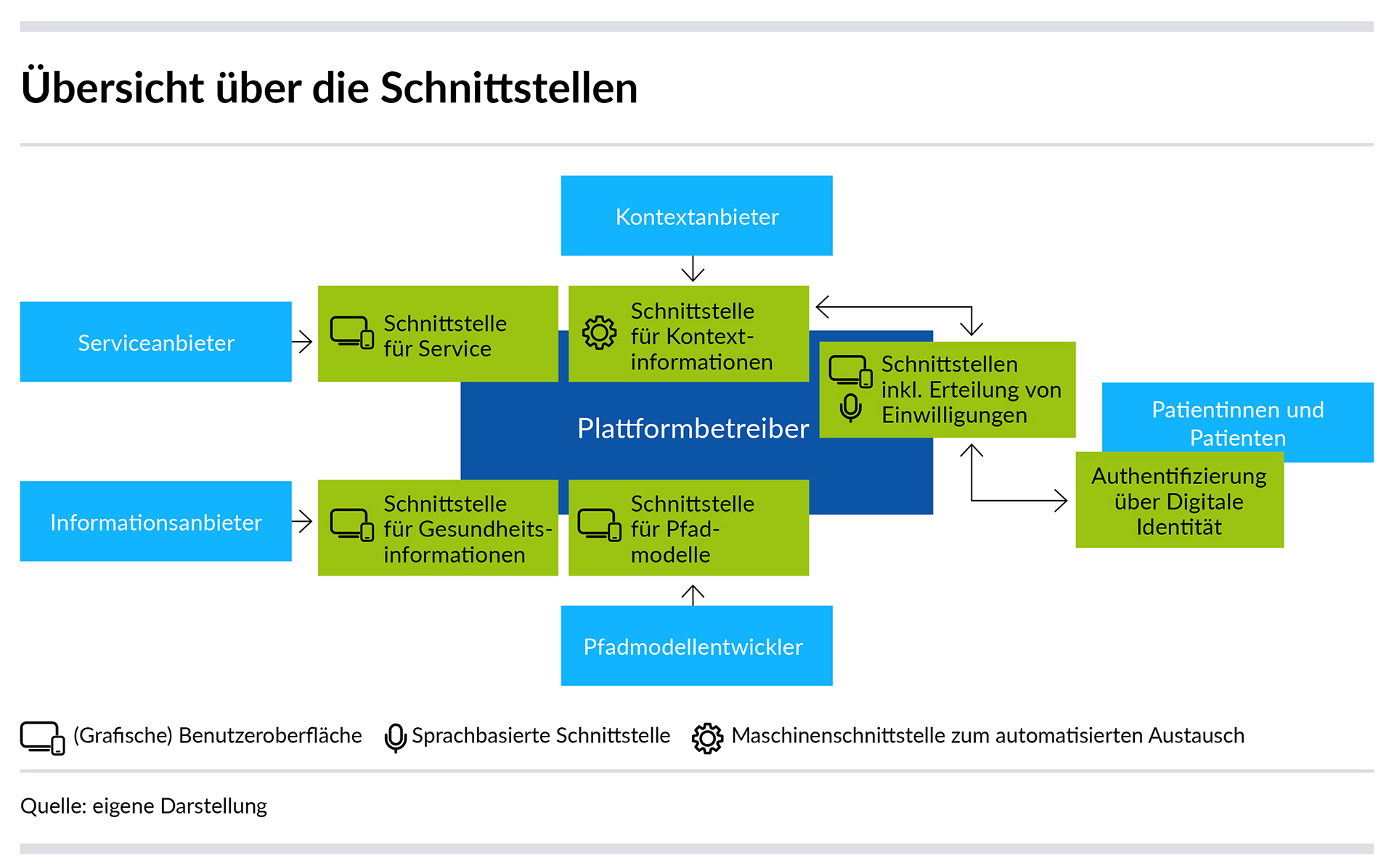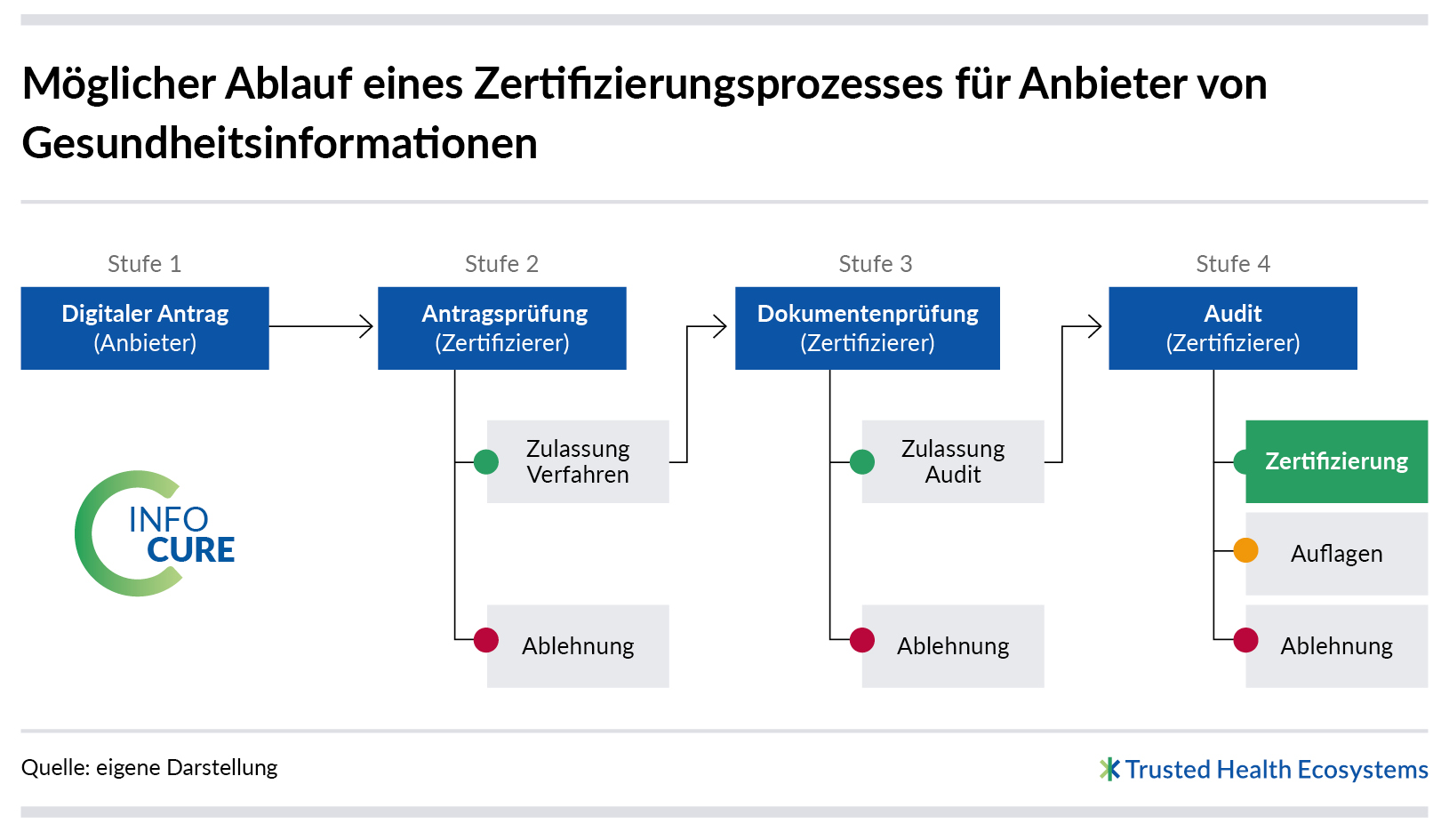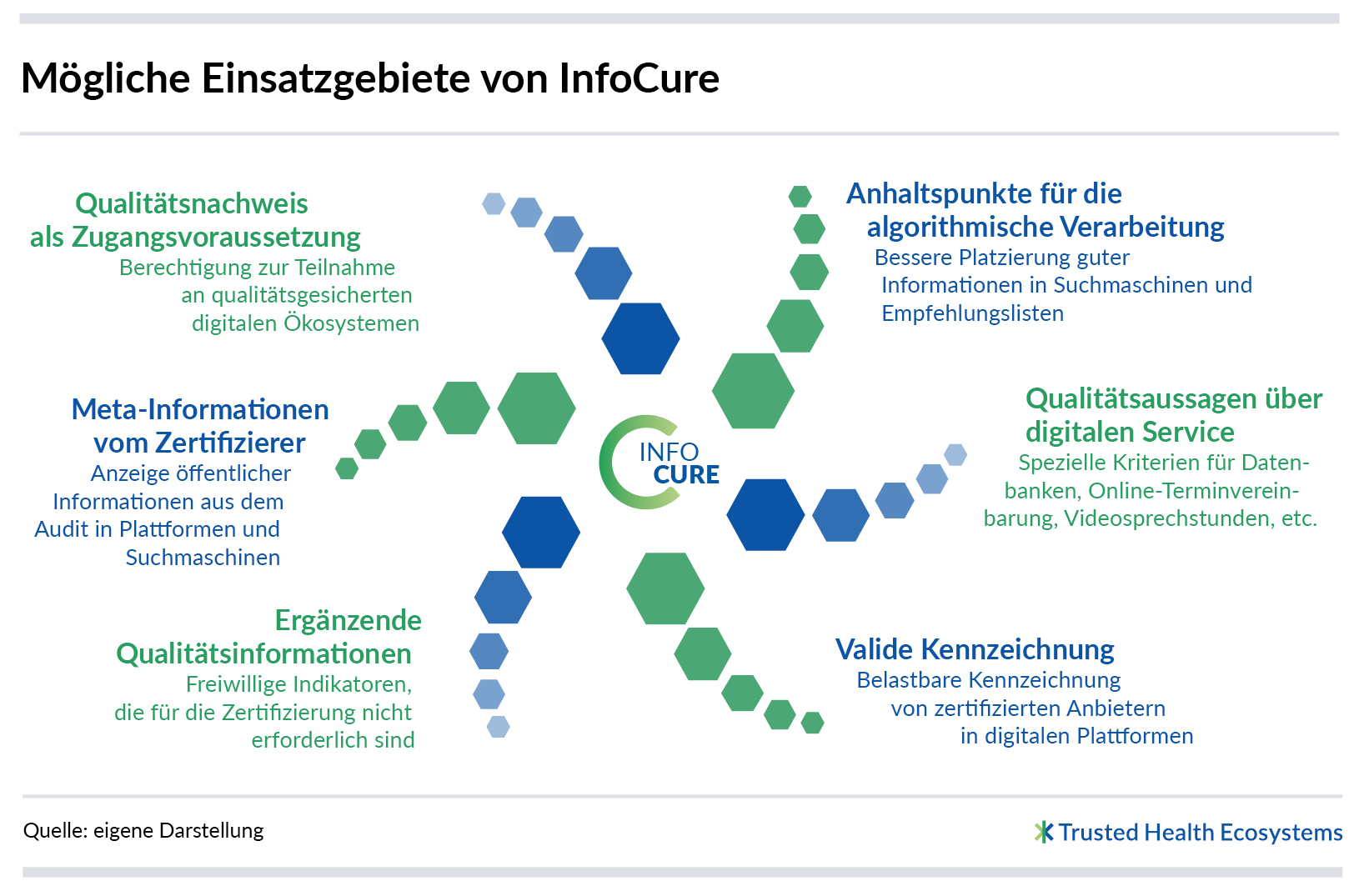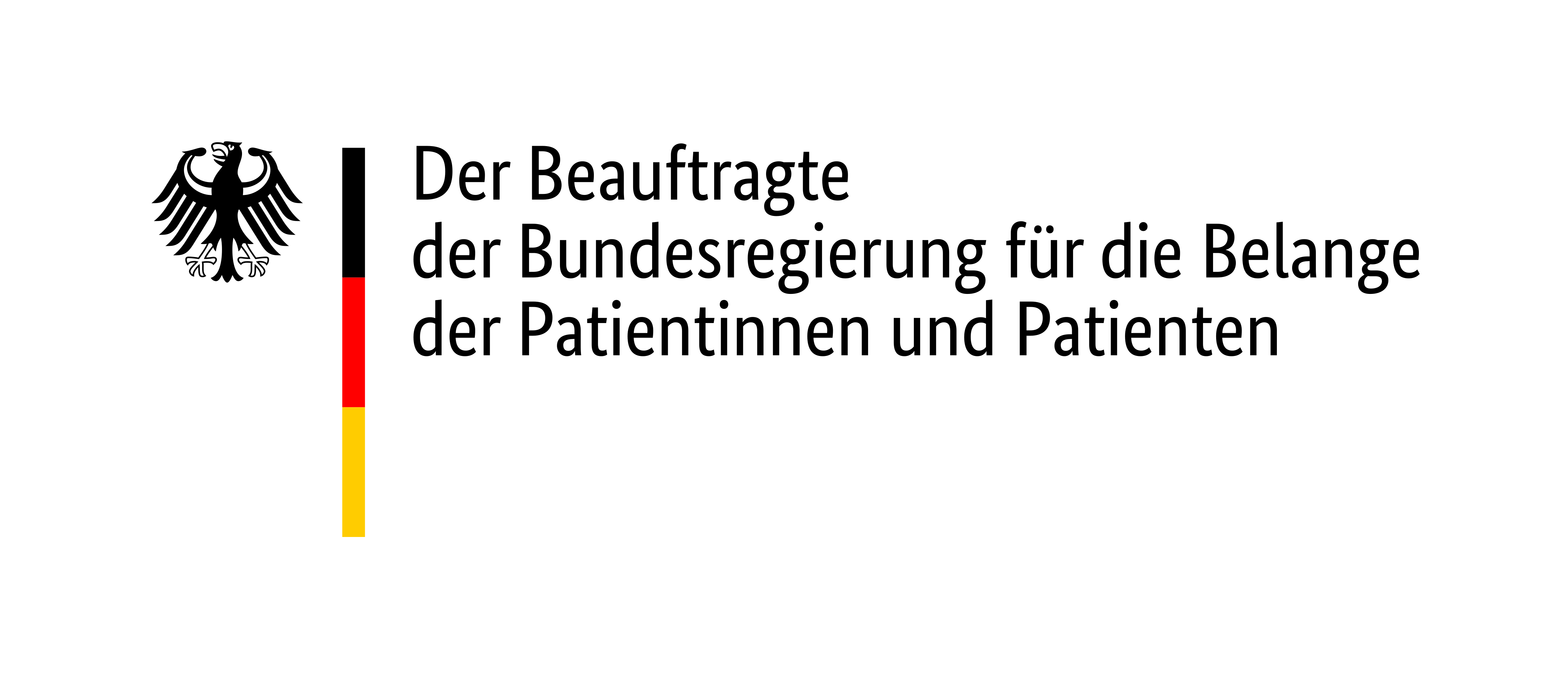Wir alle nutzen sie jeden Tag: Plattformen. Ebay, Instagram, Uber, Wolt, AirBnB … Plattformen sind nützlich, weil sie Kommunikation, Koordination und Transaktionen organisieren und so alle möglichen Aufgaben erleichtern. Aber wenn wir ehrlich sind, fühlen wir uns von ihnen auch oft auf unangenehme Weise abhängig. Im folgenden Artikel erläutere ich verschiedene Aspekte der Plattformmacht und deren Auswirkungen.
Plattformen haben Macht. Das ist ein Gemeinplatz, auf den sich alle einigen können. Doch häufig wird gestritten, welche Art von Macht sie haben. Da gibt es zum Beispiel die wirtschaftliche Macht. Plattformunternehmen verfügen oft über viel Geld und Ressourcen, um ihre Vorstellungen umzusetzen. Darüber hinaus besitzen sie Marktmacht. Häufig werden Plattformunternehmen als Monopole oder mindestens als marktdominierende Akteure beschrieben und problematisiert. Und schließlich haben Plattformen Datenmacht. Sie sammeln unzählige Daten über uns, unser Verhalten und über die Gesellschaft als Ganzes. Dazu kann man ihnen zunehmend auch politische Macht unterstellen. Sie unterhalten eine der größten Gruppen an Lobbyisten in Brüssel und Washington, und über ihre Algorithmen können sie oft auch politische Diskurse beeinflussen.
All diese Analysen sind richtig. Doch mir scheint, dass diese Felder der Macht selbst nur die Effekte einer ganz anderen Macht sind. Plattformen – so meine These – haben eine eigene, ganz spezifische Macht, und all die anderen Formen der Macht resultieren aus ihr.
Plattformmacht
Ich spreche von „Plattformmacht“ (Seemann 2021): eine Macht, die in dieser Form nur Plattformen haben und ausüben und die sich nur aus ihrer ganz speziellen Struktur heraus erklärt.
Plattformmacht besteht aus zwei Teilen:
- Netzwerkmacht, die Individuen, Institutionen und andere Teilnehmende in die Plattform zieht und sie an sich bindet.
- Kontrolle, die es Plattformbetreibern erlaubt, Einfluss auf alles zu nehmen, was auf der Plattform passiert.
Netzwerkmacht ist eigentlich nur ein anderer Name für „Netzwerkeffekte“. Dieser Begriff aus den Wirtschaftswissenschaften beschreibt den Effekt, dass Akteure immer das Netzwerk bevorzugen, in dem die meisten anderen Akteure sind. Man kennt das: Ein Social Network, bei dem niemand ist, ist nicht sehr attraktiv. Nur ein Netzwerk, in dem ich mit anderen kommunizieren kann, hat einen Wert für mich. Der Wert eines Netzwerks hängt also unmittelbar mit seiner Größe zusammen.
Dieser Effekt lässt sich aber auch als eine Form der Macht beschreiben (Grewal 2008). Meine Entscheidung, dem einen oder dem anderen Netzwerk beizutreten, ist nicht völlig frei, sondern wird stark durch die Netzwerkeffekte beeinflusst. Gleichzeitig ist es schwer, ein Netzwerk zu verlassen, in dem ich bereits viele Beziehungen aufgebaut habe. Dieser Effekt wird auch „LockIn“ genannt, weil er einen in gewisser Weise einsperrt. Netzwerkeffekte ziehen also Menschen in ein Netzwerk und halten sie dort. Daher kann man auch von „Netzwerkmacht“ sprechen.
Wir kennen Netzwerkmacht aber nicht erst seit digitalen Plattformen. Die meisten von uns haben Englisch als erste Fremdsprache gelernt. Das liegt unter anderem daran, dass es so nützlich ist, Englisch sprechen zu können, denn Englisch wird von den meisten Menschen auf der Welt gesprochen. Die Netzwerkmacht der englischen Sprache, so könnte man sagen, ist größer als die der französischen.
Netzwerkmacht gibt es überall in unserem Leben. Gesten, Sprachen, Gebräuche – sie alle haben Netzwerkmacht, denn sie sind darauf angewiesen, dass genug andere Menschen sie erkennen und interpretieren können. Auch Plattformen haben Netzwerkmacht. Doch während niemand in der Lage ist, allein Sprachen, Gesten und Gebräuche zu steuern, sie zu verändern oder Leute davon auszuschließen, können Instagram und Uber bestimmen, wer bei ihnen mitmachen darf und was jemand dort tun kann.
Hier kommt der zweite Faktor der Plattformmacht zum Tragen: die Kontrolle. Plattformen sind technische Infrastrukturen, die ihren Betreibern eine Menge Möglichkeiten einräumen, Kontrolle auszuüben. Allein durch die Ausgestaltung der Features können Plattformen bestimmen, welche Dinge auf ihnen möglich sind und welche nicht. Sie haben auch die Möglichkeit, mittels der Such-, Empfehlungs- oder Matchingalgorithmen zu steuern, welche Interaktionen auf der Plattform passieren. Und sie können auch entscheiden, bestimmte Personen von der Nutzung auszuschließen oder deren Interaktionsmöglichkeiten zu reduzieren. Kombiniert man beides – Netzwerkmacht und die Möglichkeit, Kontrolle auszuüben –, entsteht eine neue Form von Macht: die Plattformmacht.
Die Graphnahme
Jede Plattform steht zunächst vor einer Herausforderung: Um für Nutzende attraktiv zu sein, muss die Plattform Netzwerkmacht erlangen. Um diese zu erlangen, muss sie Nutzende anlocken. Es ist ein Henne-Ei-Problem, das nur schwer zu lösen ist. Plattformen haben das Problem in der Vergangenheit so gelöst, dass sie sich bereits existierende Netzwerke einverleibt haben. So hat Google sich über das World Wide Web gelegt, WhatsApp hat durch den Upload der Adressbücher seiner Nutzenden deren Kontakte importiert, Uber warb zunächst gezielt Taxifahrer ab, und Facebook ist am Anfang von Campus zu Campus gezogen und hat die Studierenden der Eliteuniversitäten motiviert, auf die Plattform zu kommen.
Den Trick, schon existierende Netzwerke in die eigene Plattform zu integrieren, um sie zur Grundlage des eigenen Netzwerkwachstums zu machen, nenne ich „Graphnahme“. Eine solche Graphnahme gewinnorientierter Plattformen könnte auch dem Gesundheitsbereich drohen. Ein denkbares Szenario dafür habe ich an anderer Stelle entwickelt (Seemann 2022).
Die Politik der Plattformen
Nach der Graphnahme ist eine Plattform nicht nur attraktiver für Außenstehende, sondern sie hat auch eine Gemeinschaft unter ihre Regeln gestellt. Wie die Landnahme ist die Graphnahme ein Akt der politischen Ordnungsgebung (Schmitt 1950). Das macht Plattformen zu politischen Institutionen: Jede Plattform wirkt politisch nach innen – meistens über Moderationsprozesse (Netzinnenpolitik) – und nach außen, weil sie sich mit anderen mächtigen Institutionen, wie anderen Plattformen oder Staaten, ins Benehmen setzen muss (Netzaußenpolitik).
Man kann heutige Politik nicht mehr verstehen, ohne die Politik der Plattformen ernst zu nehmen. Googles früheres Engagement in China, Facebooks Einfluss auf die US-Wahlen, Elon Musks Kauf von Twitter: Plattformen sind politisch, auch wenn sie lange einen anderen Eindruck erwecken wollten. Schon die Übernahme eines Vernetzungszusammenhangs selbst ist ein politischer Akt. Man stelle sich vor, eine private Plattform könnte eine ähnliche Kontrolle über das Gesundheitssystem erlangen.
Das Geschäftsmodell
Die Plattformmacht begründet aber nicht nur politische Ordnungen, sondern ist auch Grundlage aller Geschäftsmodelle von Plattformen. Jedes Plattformgeschäftsmodell verwendet auf die eine oder andere Weise Netzwerkmacht und Kontrolle als Hebel, um bestimmte Nutzergruppen zum Zahlen zu bewegen – sei es durch die Begrenzung des Zugangs zu Features oder durch Begrenzung des Zugangs zu anderen Nutzenden. Das ist offensichtlich, wenn etwa Uber und AirBnB Vermittlungsprovision kassieren, oder Amazon Gebühren von Händlern nimmt. Doch auch das Werbegeschäftsmodell ist nur der Wegzoll, den Werbekunden an die kommerziellen Plattformen zahlen, um die Nutzerschaft erreichen zu dürfen.
Enshittification
Für die gewinnorientierten Plattformen ergibt sich hier ein Widerspruch. Auf der einen Seite will eine Plattform immer wachsen, denn Wachstum ist der Weg, um Plattformmacht und damit Nützlichkeit zu erlangen – dafür muss sie sich möglichst offen geben und allen Zugang zu allem gewähren. Auf der anderen Seite will eine Plattform in der Regel auch Geld verdienen – dafür muss sie Zugänge schließen und begrenzen, denn sonst zahlt niemand Wegzoll. Diese widersprechenden Dynamiken führen dazu, dass jede Plattform mehrere Phasen durchläuft.
In der frühen Phase, also kurz nach der Graphnahme, ist eine Plattform auf Wachstum ausgerichtet. In dieser Phase versuchen die Plattformen für alle so nützlich wie möglich zu sein, um Plattformmacht zu erlangen. Erst wenn viele Leute auf die Plattform geströmt sind und sich in ihr eingerichtet haben, findet die Plattform ihr Geschäftsmodell. Die Plattform bestimmt die Engstellen, an denen sie Wegzoll nehmen will, und beginnt sie nach und nach zu schließen. Während das Wachstum abflacht, werden die Zugänge immer weiter geschlossen bzw. an immer mehr Stellen werden Wegzölle verlangt. In der nächsten Phase geht es der Plattform dann nur noch darum, den größten Profit aus der immer abhängigeren Community zu extrahieren. Die Möglichkeiten für die Nutzenden werden immer weniger, der Nutzen wird immer geringer, die Nutzung immer teurer. Der Science-Fiction-Autor Cory Doctorow und die Netzaktivistin Rebecca Giblin haben für diesen Prozess den Namen „Enshittification“ gefunden (Giblin & Doctorow 2022).
Die Ambivalenz der Plattformen: Nutzen ist Macht
Es ist ungemein schwer, Menschen dazu zu bewegen, einen gemeinsamen Standard zu etablieren. Man spricht in der Soziologie vom „Problem kollektiven Handelns“ (Olson 1965). Ist ein gemeinsamer Kommunikationsstandard erst einmal etabliert, profitieren alle Kommunikationsteilnehmerinnen und -teilnehmer davon. Das ist das große Verdienst von Plattformen. Man darf deswegen nicht vergessen: Plattformen sind aus demselben Grund nützlich, aus dem sie mächtig sind.
Plattformen sind ein Konzept zur Organisation menschlicher Interaktionen, bei denen sich Netzwerkmacht mit Kontrolle kombinieren lässt. Plattformmacht ist sowohl Grundlage des zunehmenden politischen Einflusses von Plattformen als auch ihrer Geschäftsmodelle. Da Plattformbetreiber meist kapitalistische Unternehmen sind, suchen sie Wege, um den Mehrwert, den sie generieren, wieder abzuschöpfen. Dafür müssen sie zwangsläufig die Zugänge der Interaktionen beschränken und den Nutzen der Plattformen wieder verringern.
Plattformen sind nützlich und gerade deswegen auch gefährlich. Plattform sind nicht grundsätzlich abzulehnen, aber man sollte sehr aufpassen, von welchen Plattformen man sich abhängig macht. Insbesondere, wenn es um sensible gesellschaftliche Zusammenhänge wie etwa die Gesundheitsversorgung geht.
Literatur
Giblin R, Doctorow C (2022). Chokepoint Capitalism: How Big Tech and Big Content Captured Creative Labor Markets and How We’ll Win Them Back. Boston.
Grewal D S (2008). Network Power. The Social Dynamics of Globalization. New Haven.
Olson M (1965). The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge.
Schmitt C (1950). Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum. Berlin.
Seemann M (2014). Das Neue Spiel. Strategien für die Welt nach dem digitalen Kontrollverlust. Freiburg.
Seemann M (2021). Die Macht der Plattformen. Politik in Zeiten der Internetgiganten. Berlin.
Seemann M (2022). Die Graphnahme der Gesundheit. Ein Planspiel zur möglichen Plattformisierung des deutschen Gesundheitssystems. Baas J (Hrsg.). Gesundheit im Zeitalter der Plattformökonomie. Ziele. Herausforderungen. Handlungsoptionen. Berlin. 50–58.
Autor
Michael Seemann studierte Angewandte Kulturwissenschaften und promovierte 2021 in Medienwissenschaften. Er startete 2010 einen Blog zum Verlust der Kontrolle über die Daten im Internet und veröffentlichte seine Thesen 2014 unter dem Titel „Das Neue Spiel“ auch als Buch. Sein zweites Buch, „Die Macht der Plattformen“, erschien 2021. Zum Thema Plattformregulierung war er 2016 als Sachverständiger im Bundestag. Er hält Vorträge zu den Themen Internetkultur, Plattformen, Künstliche Intelligenz und die Krise der Institutionen in Zeiten des digitalen Kontrollverlusts.