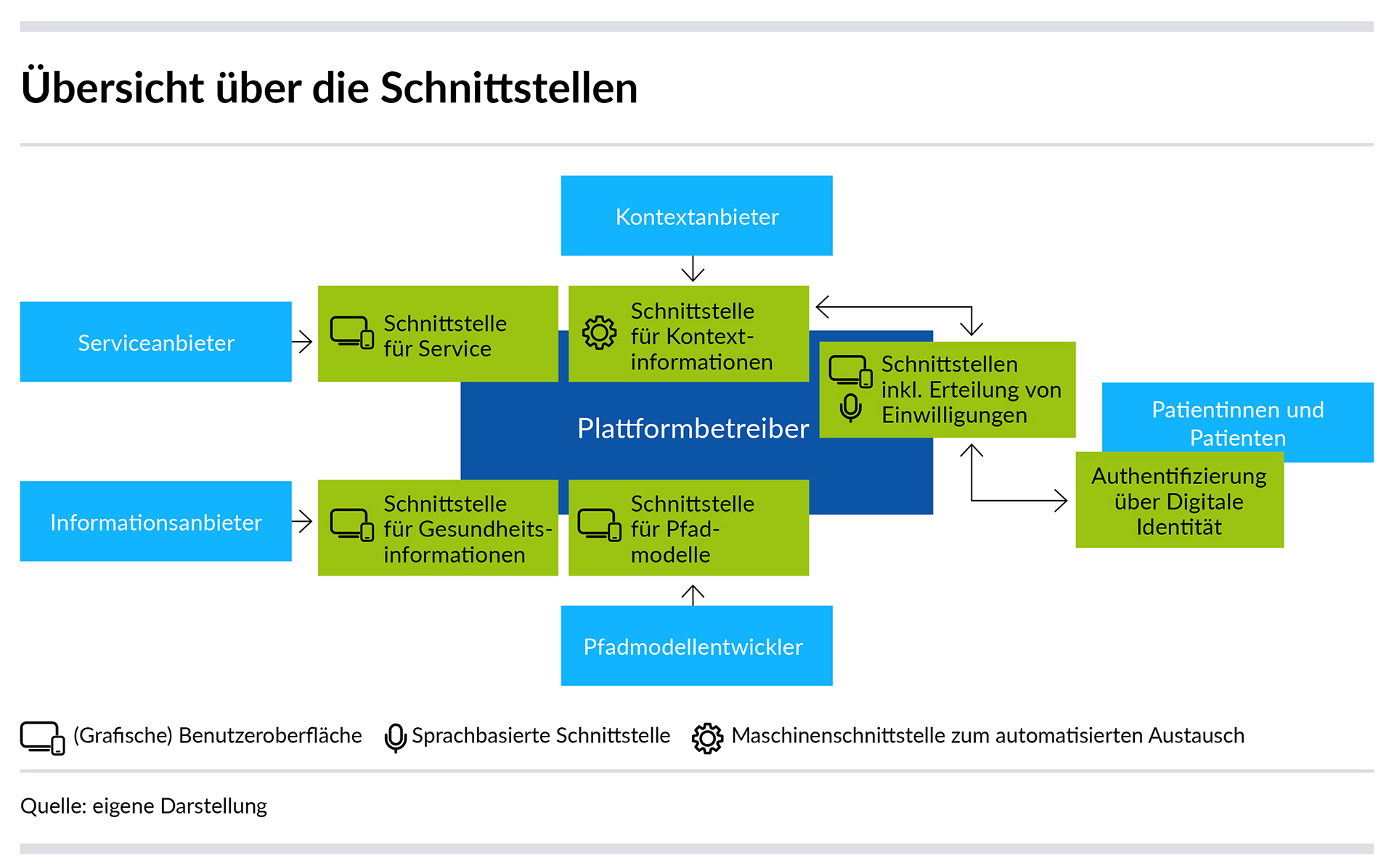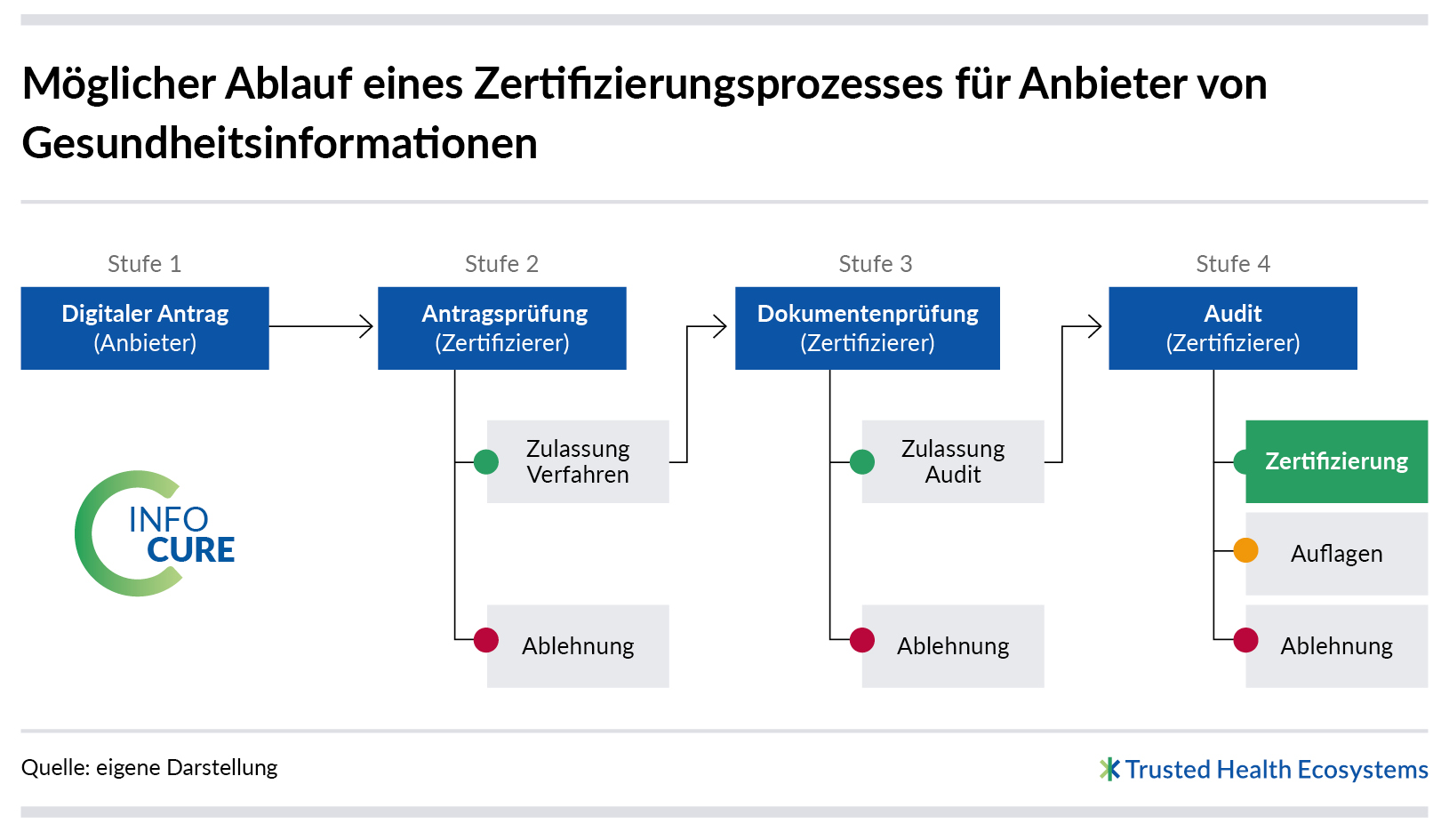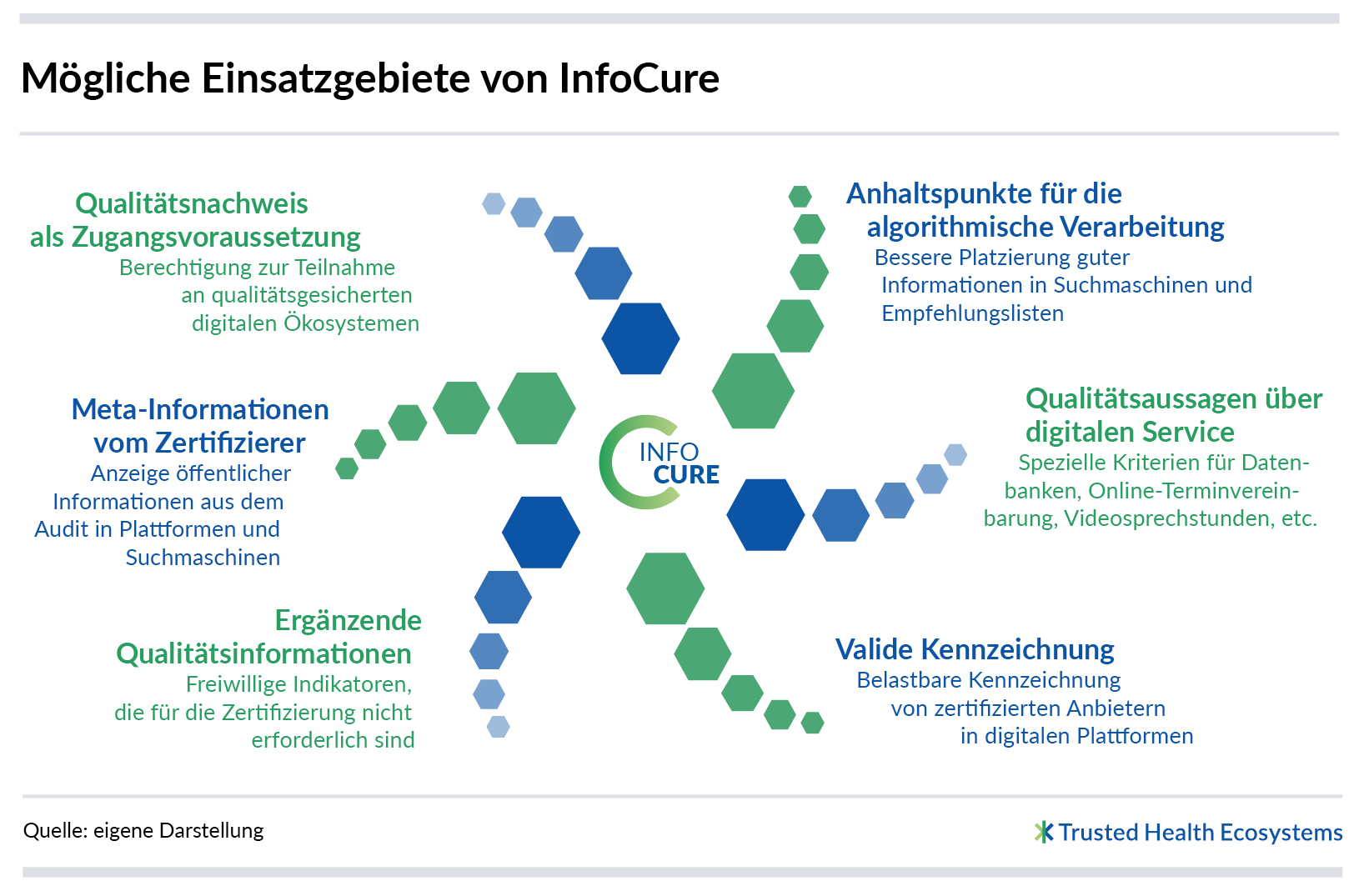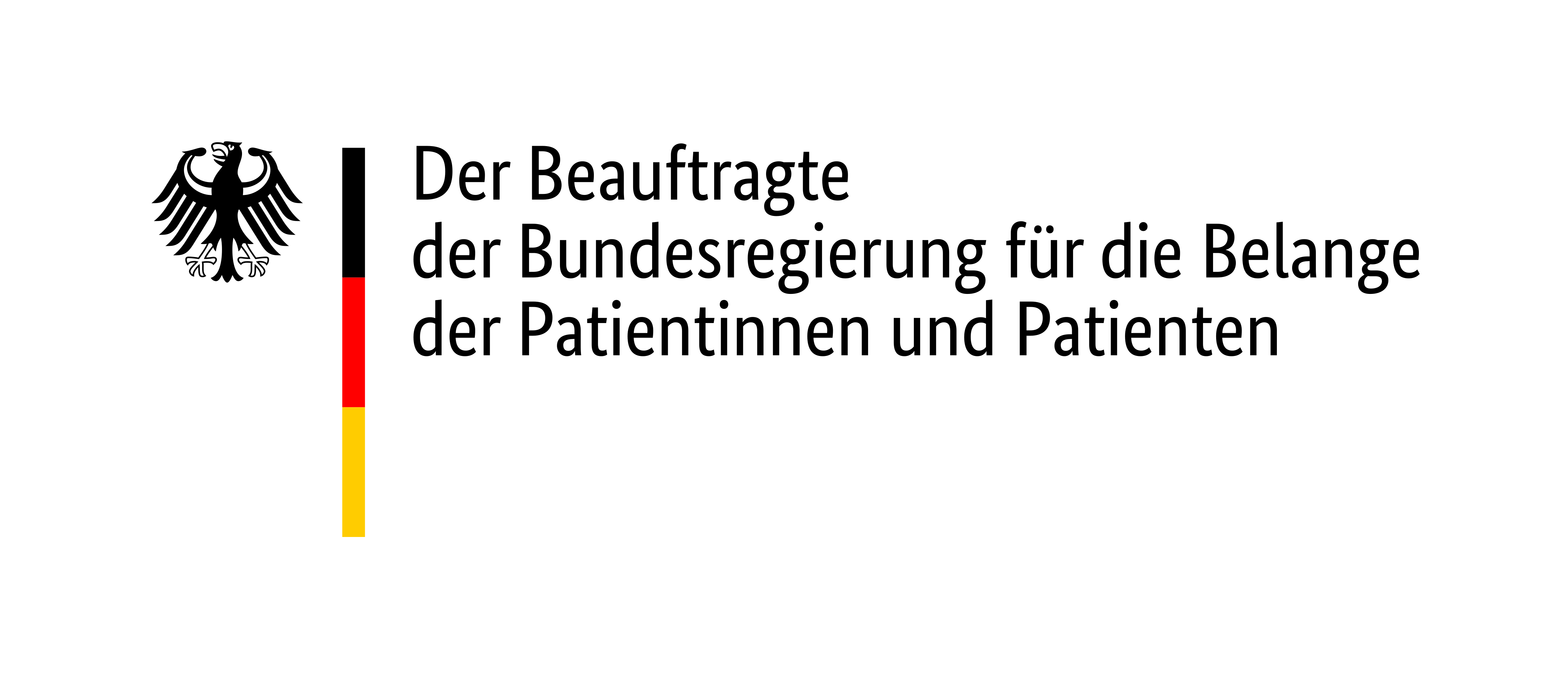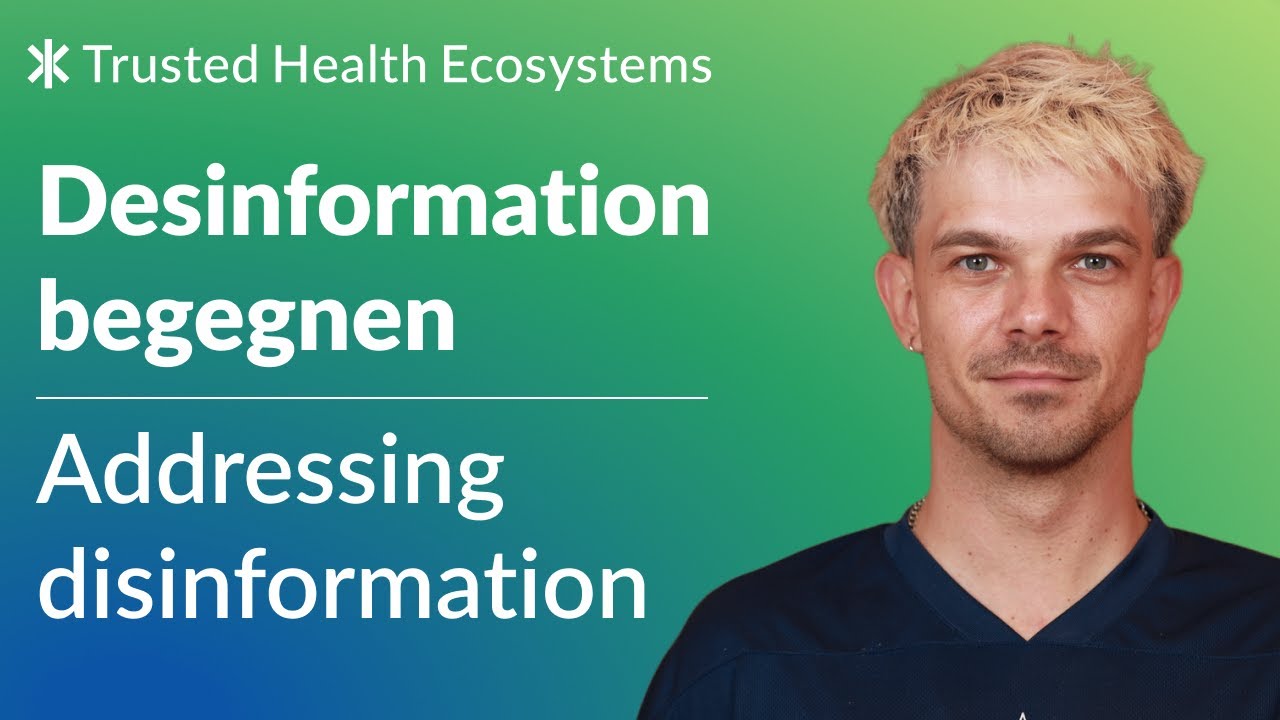Intro
Wenn man jetzt die nationale Gesundheitsplattform als zentrale Drehscheibe versteht und bei diesem Projekt staatliche Akteure mitwirken sollen, müssen auch die für staatliche Akteure geltenden rechtlichen Voraussetzungen eingehalten werden.
Was ist staatliches Informationshandeln und was hat das mit der Idee einer nationalen Gesundheitsplattform zu tun?
Als staatliches Informationshandeln kann man erstmal jede Form der Kommunikation von Informationen durch staatliche Akteure betrachten. Das sind zum Beispiel die Aufklärung über bestimmte Sachverhalte wie bestimmte Krankheitsbilder oder auch die Empfehlung bestimmter Verhaltensweisen etwa 10.000 Schritte am Tag zu gehen, aber auch die Warnung vor bestimmten Produkten, etwa die Einnahme bestimmter Medizinprodukte. Und dabei ist es erstmal egal von welcher staatlichen Stelle die Information ausgeht, das heißt etwa von einem Bundesministerium oder von Landesparlamenten oder aber durch eine kommunale Einrichtung.
Warum unterliegt staatliches Informationshandeln besonderen rechtlichen Anforderungen?
Staatliches Informationshandeln unterliegt deshalb besonderen rechtlichen Anforderungen, weil staatliche Stellen in der Regel bei ihrer Informationstätigkeit auf ganz andere Ressourcen zurückgreifen können als privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen dies können. Insbesondere genießen staatliche Stellen bei ihrer Informationstätigkeit in der Regel eine große öffentliche Aufmerksamkeit und auch eine gewisse Autorität beziehungsweise das Vertrauen von Patientinnen.
Das bedeutet konkret, dass wenn etwa ein Bundesministerium vor dem Einsatz eines Medizinproduktes warnt, dies faktisch oftmals dem Verbot des Produktes gleich kommt, denn Bürgerinnen werden dies in der Zukunft voraussichtlich nicht mehr kaufen, wenn vor dem Produkt gewarnt wurde durch staatliche Stellen. Dies bedeutet, staatliches Informationshandeln kann faktisch extreme Einflüsse auf Marktgeschehnisse nehmen. Insbesondere kann staatliches Informationshandeln damit das Grundrecht auf Berufsfreiheit anderer Anbieter digitaler Gesundheitsangebote beeinflussen.
Welche Empfehlungen lassen sich daraus für die Trägerschaft einer nationalen Plattform ableiten?
Wenn und soweit staatliche Akteure an der nationalen Gesundheitsplattform partizipieren sollen, sind natürlich auch die für diese Stellen geltenden rechtlichen Anforderungen einzuhalten. Diese sind verhältnismäßig hoch. In der Regel wird es hierfür einer gesetzlichen Grundlage bedürfen. Selbst wenn Produktwarnungen gar nicht im Fokus des Projektes stehen, liegt es nahe, dass die Grundrechte von Anbietern digitaler Gesundheitsangebote durch ein solches Vorhaben beeinträchtigt werden könnten.
Dies legt eine staatsferne Trägerschaft für die nationale Gesundheitsplattform nahe, beziehungsweise ein strukturoffenes Trägermodell in zivilgesellschaftlicher Verantwortung. Und dabei wäre nicht mal eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln ausgeschlossen, denn eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln bedeutet nicht zwangsläufig, dass auch das gewählte Trägermodell ein öffentlich-rechtliches sein muss.
Disclaimer
Die in dem Interview getroffenen Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die Rechtslage in Deutschland. Sie stellen einen Leitfaden und gerade keine individuelle Rechtsberatung dar, die über das Projekt Trusted Health Ecosystems hinausgeht.
Expertin
Prof. Dr. Laura Schulte arbeitete während ihrer Promotion an einem Lehrstuhl für Verfassungsrecht als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie promovierte zu einem datenschutzrechtlichen Thema und forschte hierzu unter anderem auch an der Queen Mary School of Law in London. Von 2020 bis 2023 war sie als Rechtsanwältin in der Kanzlei BRANDI-Rechtsanwälte am Standort Bielefeld und dort im Fachbereich IT- und Datenschutzrecht tätig. Seit August 2023 ist sie Professorin für Wirtschaftsrecht an der Hochschule Bielefeld.